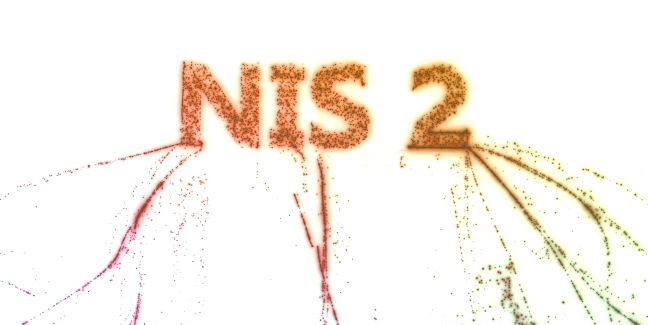Digitale Märkte und Dienste: Das ändert sich

Online-Dienste und Plattformen sind für viele Unternehmen aller Größen fester Bestandteil ihrer Geschäftsaktivitäten, jedoch prägen einige wenige große Plattformen das Marktgeschehen. Mit dem neuen digitalpolitischen Rechtsrahmen der EU für das Internet wird sich einiges ändern. Dabei geht es nicht nur um fairere Wettbewerbsbedingungen für KMU. Eingeführt werden auch strengere Regeln für fast alle Unternehmen der Online-Ökonomie, damit Verbraucher*innen künftig besser vor illegalen Geschäftspraktiken geschützt werden – auch für die Mandantschaft von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wird hier neuer Beratungsbedarf entstehen.
Mit dem Digitalpaket der EU - bestehend aus Digital Markets Act und Digital Services Act - werden sich die Marktbedingungen für KMU gegenüber den zentralen Online-Plattformen verbessern. Aber es werden auch fast alle Unternehmen, die im Internet geschäftlich tätig sind, beim Verbraucherschutz stärker in die Pflicht genommen. Wirtschaftsprüfer*innen können die Unternehmen der Digital-Ökonomie bei der Einhaltung der neuen Regeln und dem Management der Risiken unterstützen.
In den Frühzeiten des Autoverkehrs im Jahr 1914 war es die erste Verkehrsampel, die Ordnung auf die Straßen gebracht hat. Gleiches soll nun im Internet passieren: Auf Initiative von Margrethe Vestager, die in der EU-Kommission damit betraut ist, Europa fit fürs Digitalzeitalter zu machen, sollen in Europa verbindliche Regeln geschaffen werden, ein „Grundgesetz für das Internet“. Dazu dienen der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Service Act (DSA), die beide bereits beschlossene Sache sind.
Digitale Märkte: Marktmacht von Gatekeepern begrenzen
Der Digital Markets Act (DMA) begrenzt die Marktmacht sehr großer Online-Plattformen wie Amazon, Facebook, Youtube und Google. Diese kontrollieren die Zugangstore der Märkte und haben daher als Gatekeeper eine gefestigte Position zwischen gewerblichen Nutzern und Endkunden inne. Sie erwirtschaften auch den größten Teil des generierten Wertes, obwohl in der EU über 10.000 Online-Plattformen ihre Dienste anbieten, darunter rund 90% kleine und mittelgroße Unternehmen.
Betreiber zentraler Plattformen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, müssen nach dem DMA künftig:
- Dritten ermöglichen, mit den eigenen Diensten des Gatekeepers zusammenzuarbeiten – die zentralen Anbieter sollen also Interoperabilität gewährleisten, u.a. beim Versenden von Textnachrichten und Bildern mit Messenger-Diensten,
- ihren gewerblichen Nutzern Zugriff auf deren Daten auf der Gatekeeper-Plattform gewähren,
- ihren gewerblichen Nutzern erlauben, auch außerhalb der Plattform mit Kunden Verträge abzuschließen.
Außerdem sieht der DMA in seinem Art. 13 eine Prüfungspflicht vor: Gatekeeper haben eine von unabhängiger Stelle geprüfte Beschreibung ihrer verwendeten Techniken zur Erstellung von Verbraucherprofilen vorzulegen und diese Beschreibung jährlich zu aktualisieren.
Untersagt ist es Gatekeepern künftig, ihre eigenen Produkte auf ihrer Plattform zu bevorzugen, beispielsweise bei der Reihung auf ihrem digitalen Marktplatz. Auch dürfen sie Nutzer nicht mehr daran hindern, vorab auf ihren Geräten installierte Software zu deinstallieren. Zudem soll das Verfolgen von Nutzern außerhalb der Plattform mit gezielter Werbung der Vergangenheit angehören.
Bei Verstößen kann die EU-Kommission auf verschiedene Sanktionen zurückgreifen, die Geldbußen von bis zu 20 % des Jahresumsatzes bei Wiederholungstätern umfassen, Zwangsgelder von bis zu 5% des Tagesumsatzes, und sie darf sogar als letztes Mittel die Veräußerung von Geschäftsbereichen verfügen.
Direkt betroffen vom DMA sind zwar nur einige wenige Anbieter, die als Gatekeeper eingestuft werden. Indirekt profitieren von dem Abbau von Markteintrittsbarrieren aber vor allem kleinere Plattformen und KMU, die ihre Produkte online vertreiben, sowie Technologie-Start-ups mit digitalen Geschäftsmodellen.
Die neuen Regeln für digitale Märkte dürften im Lauf der ersten Jahreshälfte 2023 wirksam werden: Im Juli 2022 passierte der DMA das Europäische Parlament und den Rat. Nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt gilt die Verordnung sechs Monate und zwanzig Tage später in allen Mitgliedstaaten unmittelbar.
Digitale Dienste
Was offline illegal ist, soll es auch online sein – dieses Grundprinzip verfolgt der Digital Services Act (DSA). Ob Hassrede oder Handel mit gefälschten Produkten – Online-Plattformen werden mit dem DSA stärker in die Verantwortung genommen, was auf ihren Marktplätzen passiert. Der DSA betrifft Online-Dienste, die täglich von Millionen von Menschen genutzt werden und hat daher einen sehr weiten Anwendungsbereich. Er gilt für „Vermittlungsdienste“ – Internet-Anbieter, die ihre Dienste für Nutzer in der EU anbieten – unabhängig davon, wo der Anbieter selbst ansässig ist.
Das „digitale Grundgesetz für Europa“ beschäftigt sich zum einen mit der Haftung der Anbieter. Allerdings sind die Anbieter nicht allgemein, sondern nur auf Anordnung von Behörden dazu verpflichtet, gegen illegale Inhalte vorzugehen und Informationen zu liefern. Zum anderen erlegt der DSA den Anbietern bestimmte Sorgfaltspflichten auf, die folgendermaßen nach Art und Größe der Anbieter abgestuft sind:
- Alle Anbieter: Sie müssen u.a. eine zentrale Kontaktstelle einrichten,
- Hosting-Anbieter wie Cloud- und Webhosting-Dienste: Sie müssen Nutzern ermöglichen, mutmaßlich illegale Inhalte zu melden,
- Online-Plattformen wie Online-Marktplätze, App-Stores, Plattformen der kollaborativen Wirtschaft und Social-Media-Plattformen: Sie müssen u.a. ein internes Beschwerdemanagementsystem einrichten und haben Meldepflichten bei Hinweisen auf schwere Straftaten (für KMU werden die Maßnahmen lediglich empfohlen),
- Sehr große Online-Plattformen (über 45 Mio. aktive Nutzer in der EU pro Monat): Sie müssen ein Risikomanagementsystem einrichten und sich jährlich von einem Externen prüfen lassen.
Potenziale für Wirtschaftsprüfende bietet die letztgenannte Prüfungspflicht sehr großer Plattformen. Aber auch bei weiteren Unternehmen der Online-Ökonomie wird durch die neuen Regeln Prüfungs- oder Beratungsbedarf im Zusammenhang mit Governance, Risk & Compliance entstehen.
Die neuen Regeln für digitale Dienste werden spätestens ab dem 1. Januar 2024 in der EU unmittelbar gelten – bzw. 15 Monate und 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, falls dieser Zeitpunkt früher eintritt. Das Europäische Parlament hat dem DSA bereits im Juli 2022 zugestimmt.